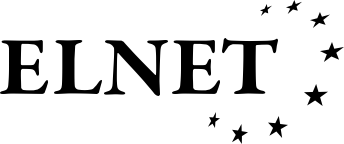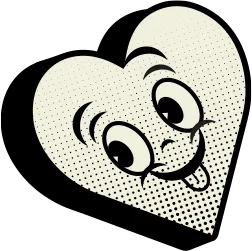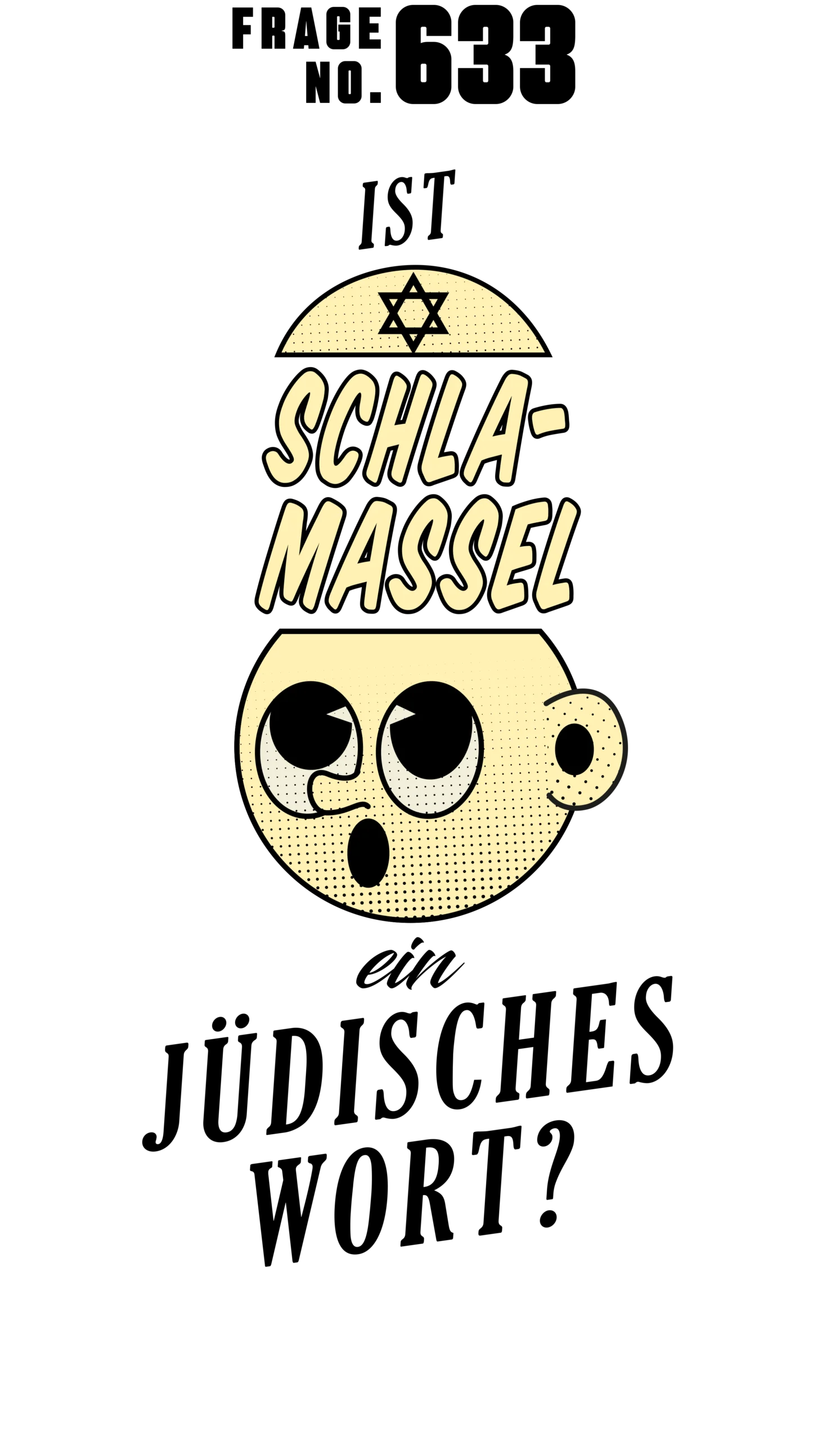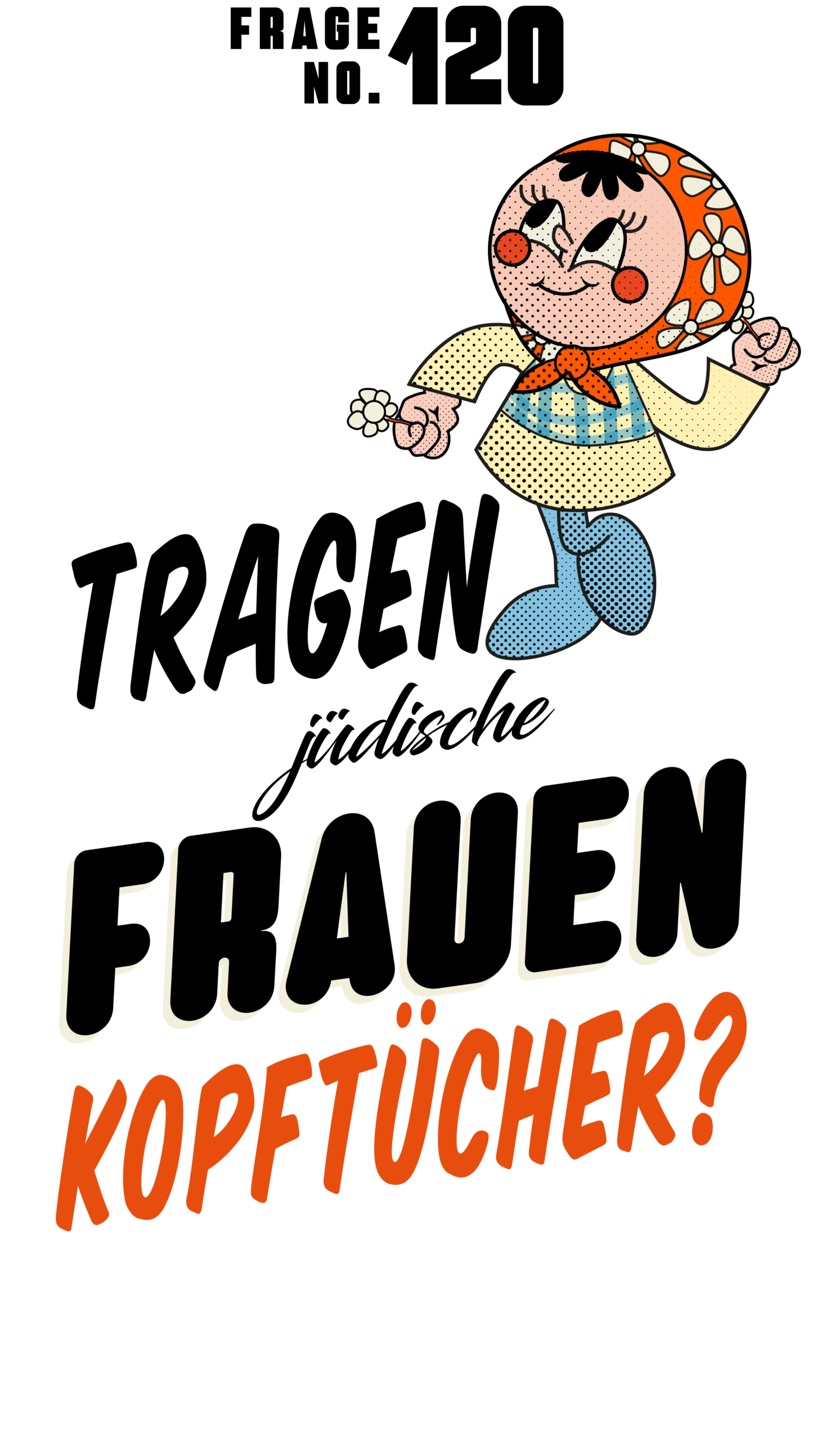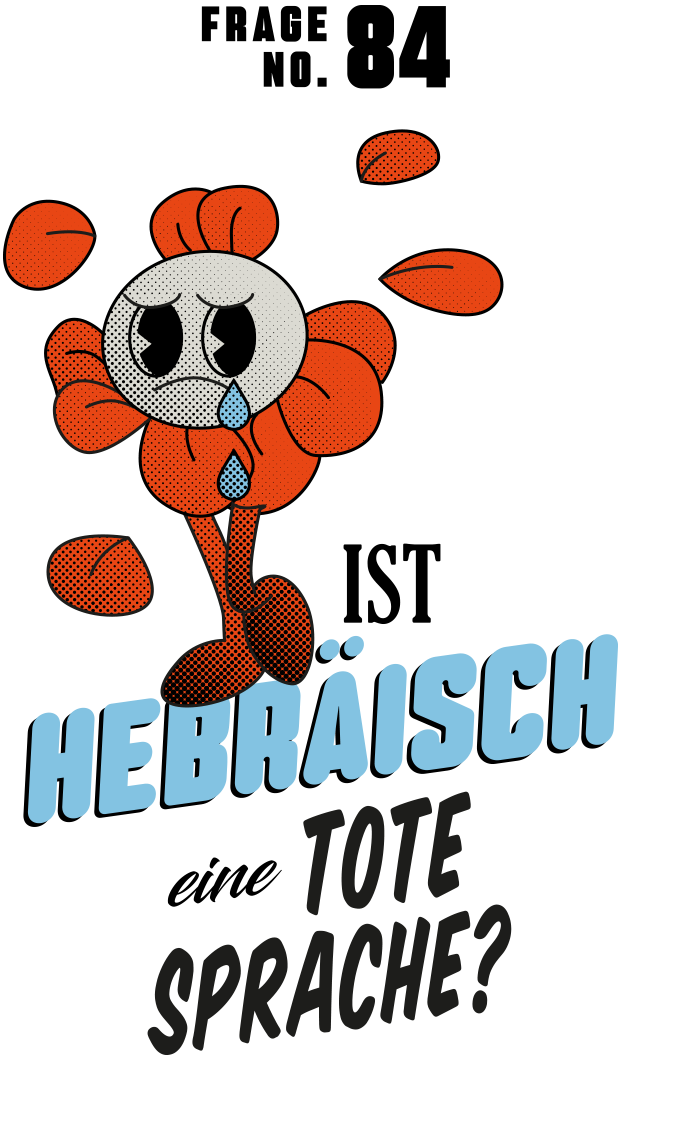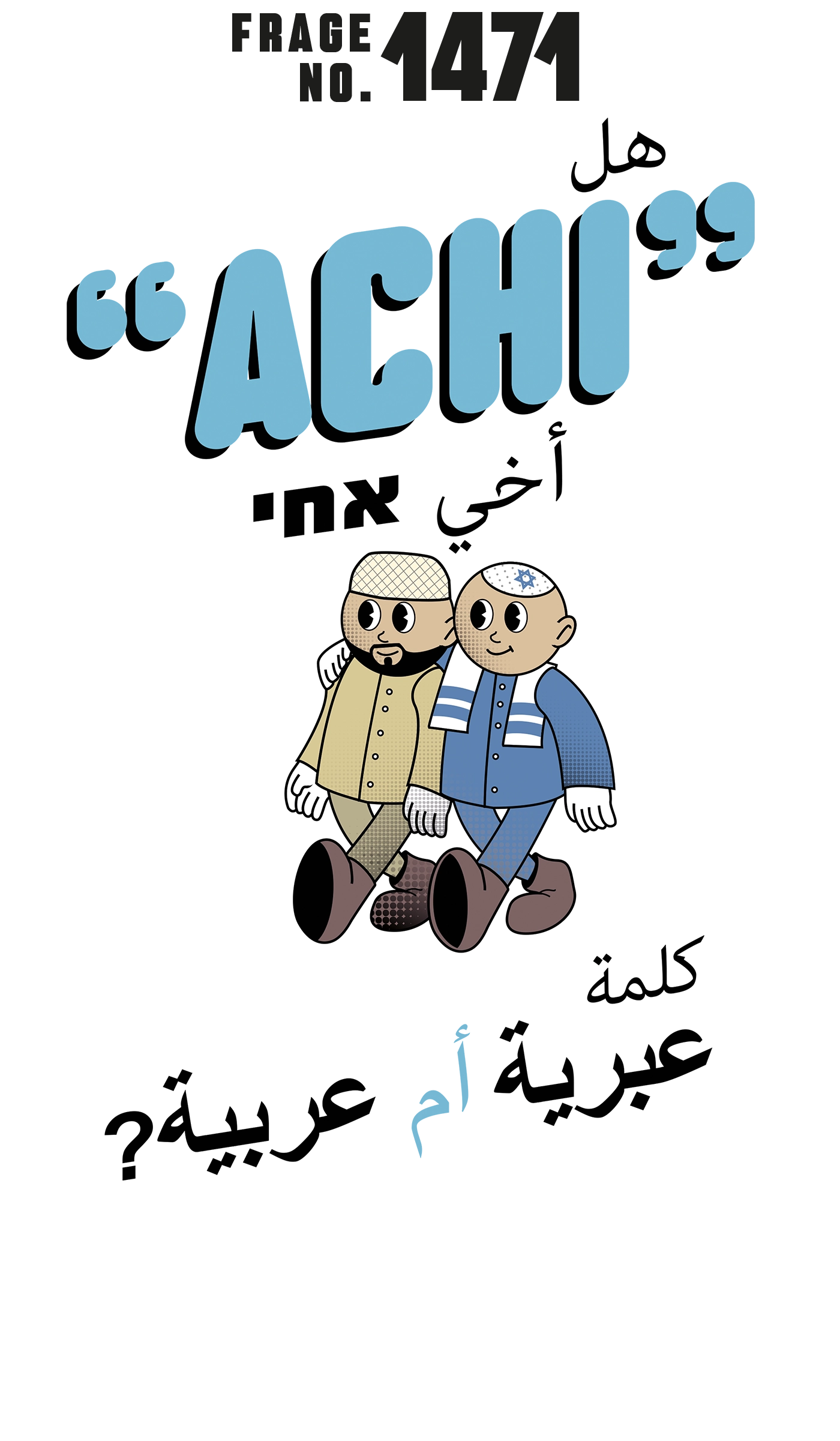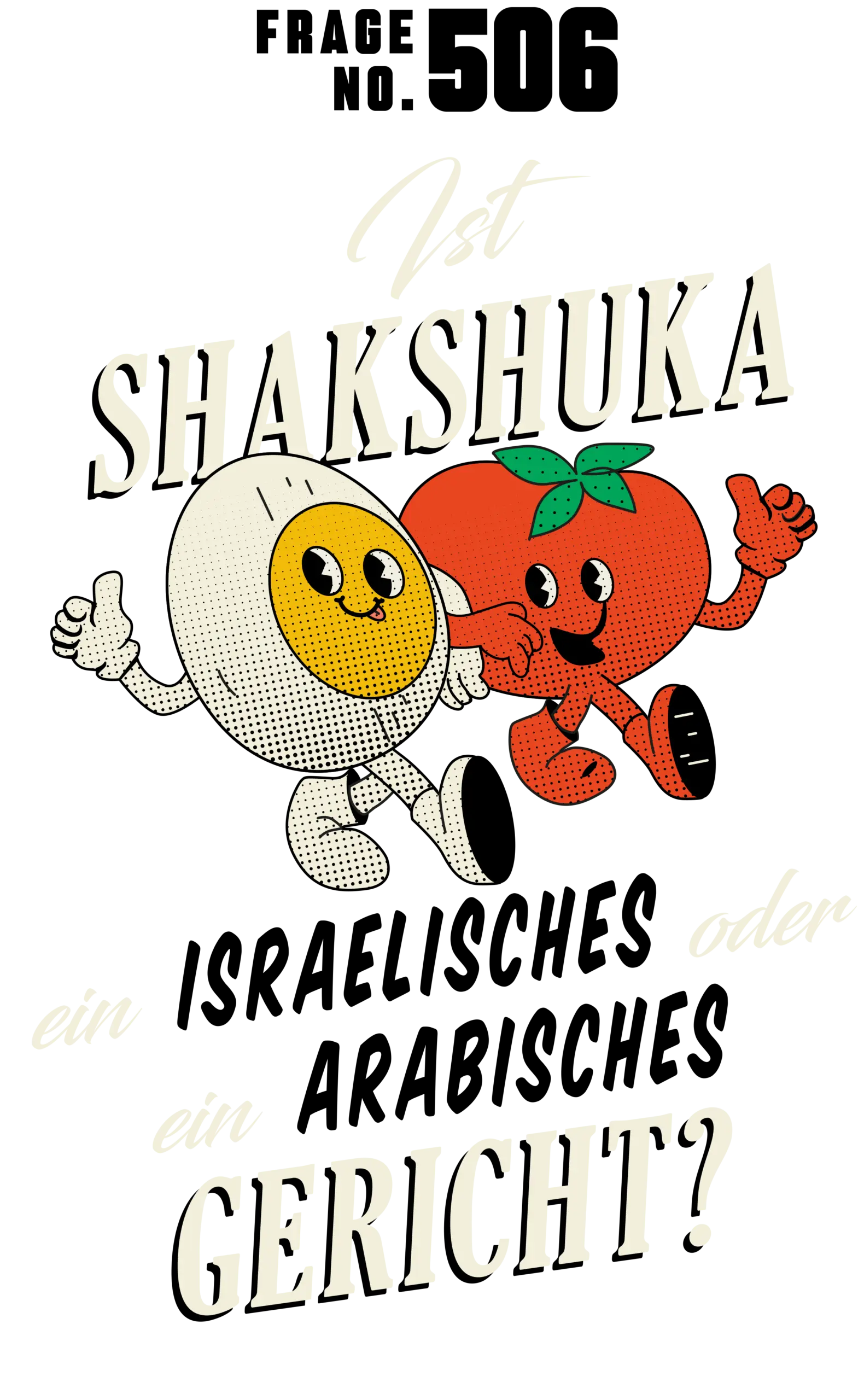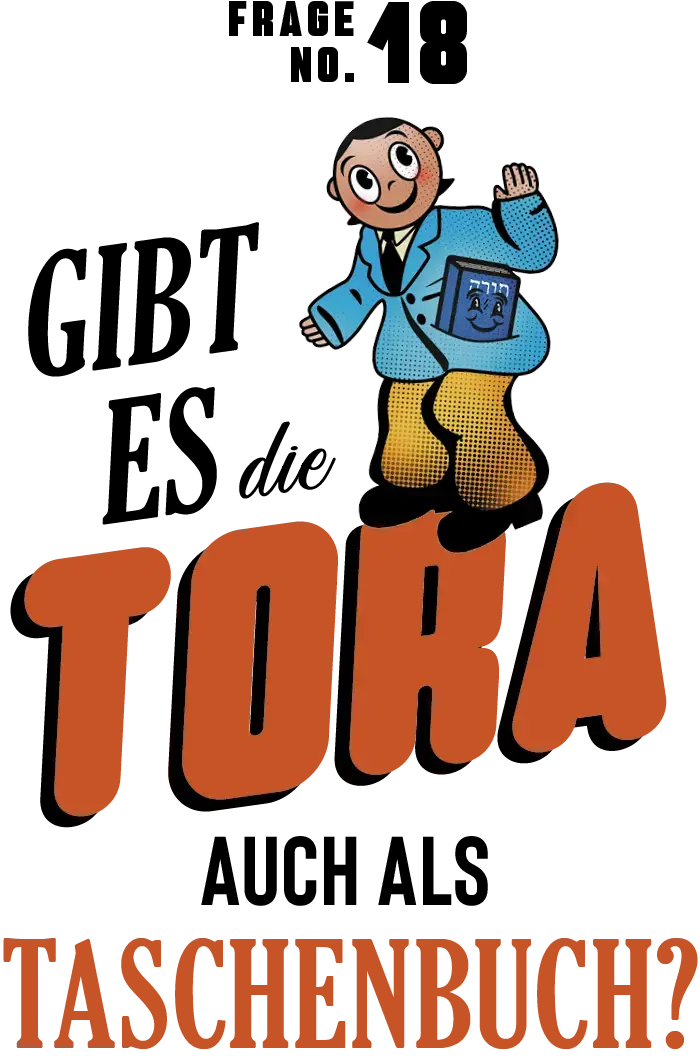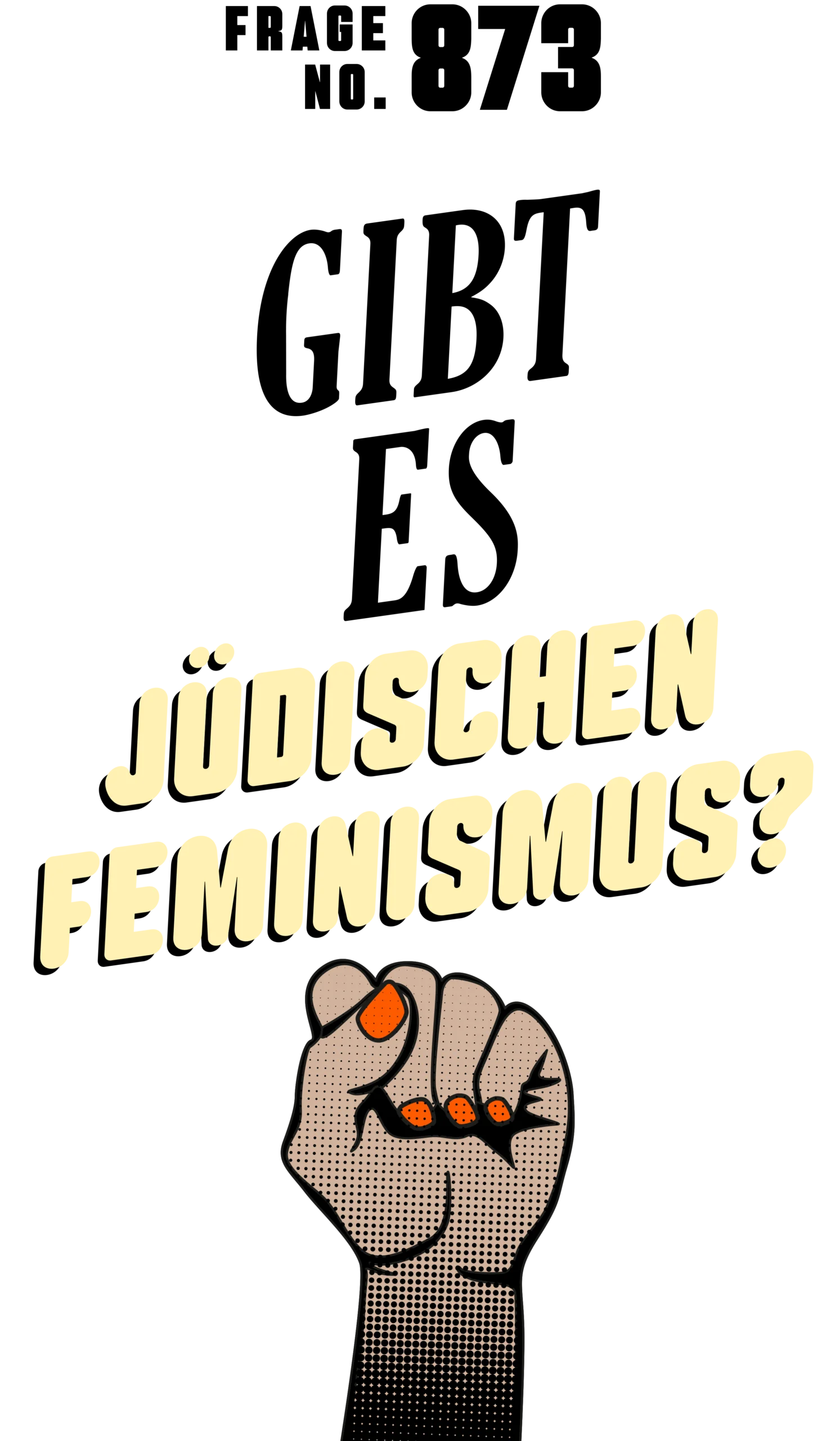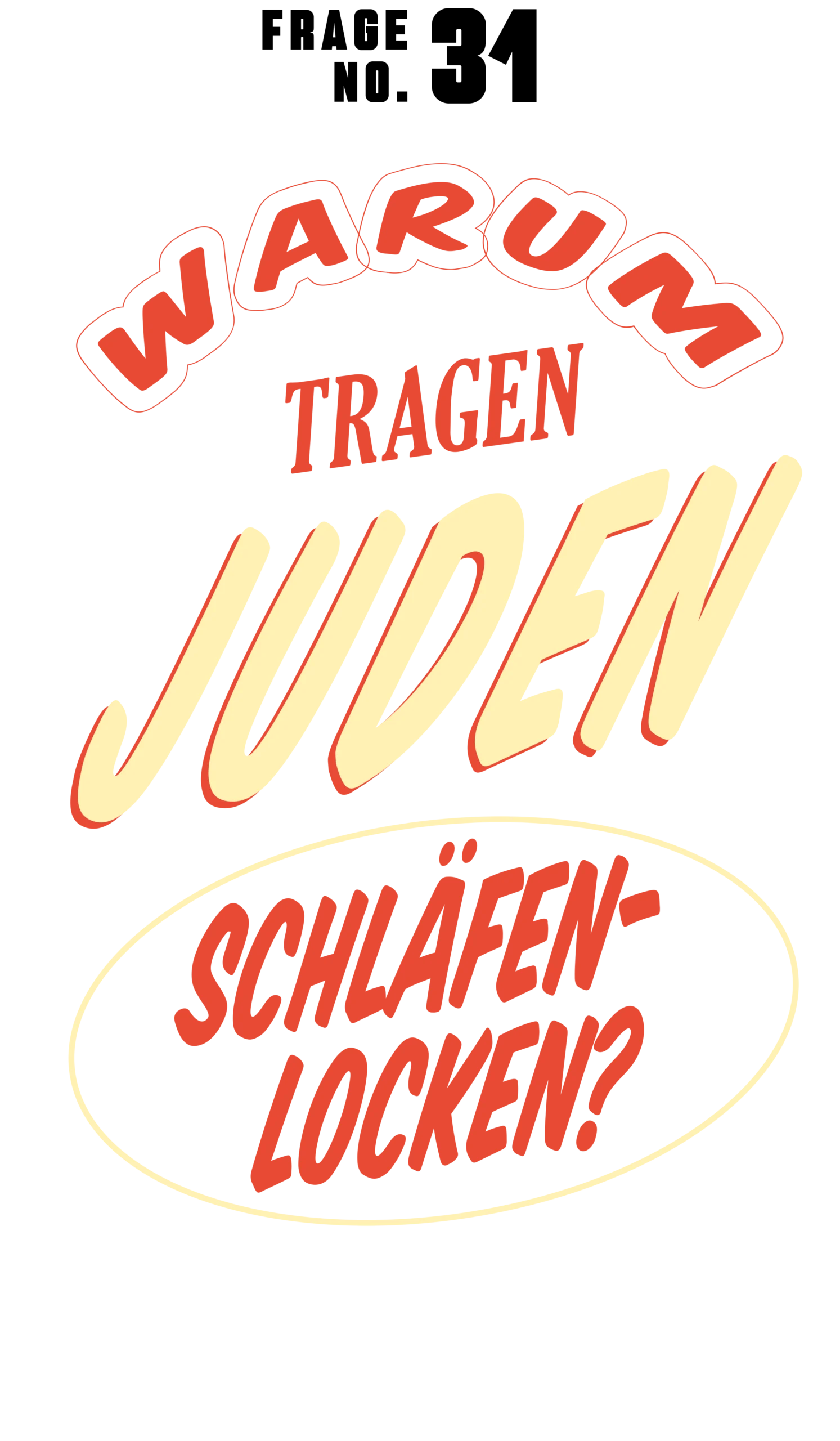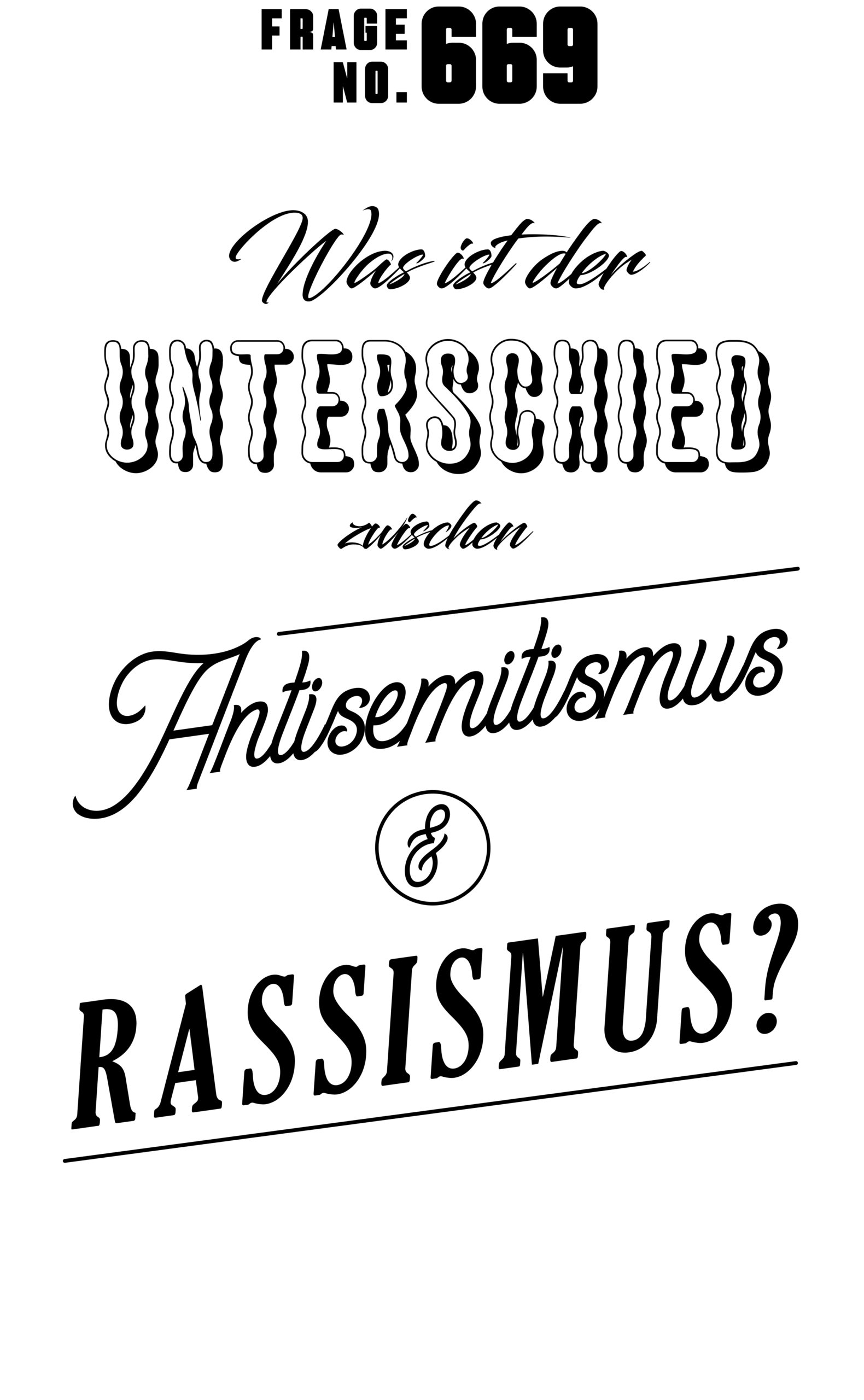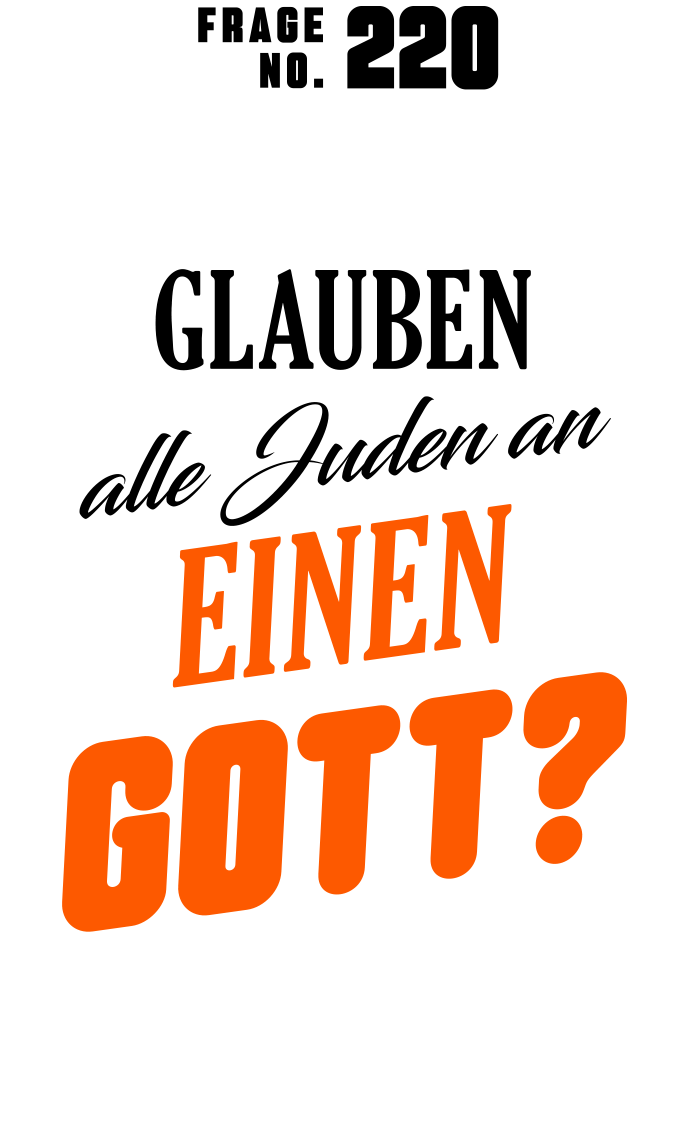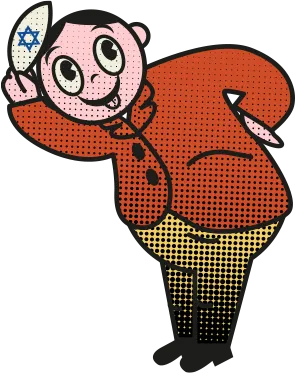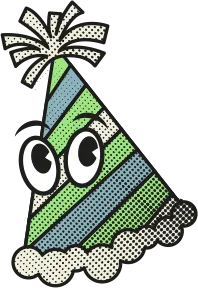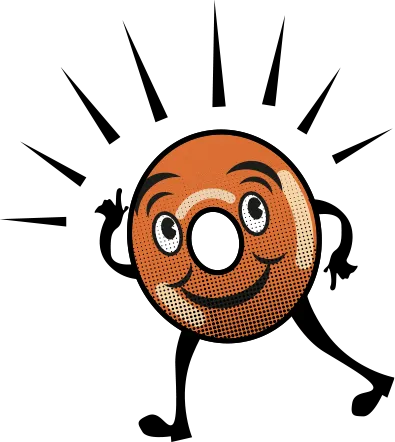Im traditionellen Judentum gilt eine Person als jüdisch, wenn die Mutter Jüdin ist – eine Regel, die sich aus rabbinischen Auslegungen der Spätantike (ab ca. 200 n. d. Z.) ableitet. Historisch diente diese Regel vor allem dem Schutz von Kindern bei unklarer Vaterschaft.
Die Frage, warum das Jüdischsein nach dem jüdischen Religionsgesetz, der Halacha, über die Mutter vererbt wird, führt tief in die jüdische Religionsgeschichte und Rechtstradition. Während in der Hebräischen Bibel oft die väterliche Linie betont wird, etablierte sich in talmudischer Zeit (ca. 200–500 n. d. Z.) eine Regelung, die das Jüdischsein über die Mutter vererbt. Eine zentrale Quelle hierfür ist die talmudische Stelle Kidduschin 68b, in der erklärt wird, dass die Identität der Mutter eindeutig bestimmbar sei – im Gegensatz zu der des Vaters. Gerade in Zeiten, in denen Jüdinnen systematischer Gewalt und Vergewaltigung ausgesetzt waren, gewährte diese Regel einen Schutz: Kinder jüdischer Mütter wurden als jüdisch anerkannt und in die Gemeinschaft aufgenommen – unabhängig von der Herkunft des Vaters.
Heute ist diese Regelung Gegenstand intensiver innerjüdischer Debatten. In liberalen und reformierten Strömungen werden häufig auch Kinder jüdischer Väter als jüdisch anerkannt, sofern sie jüdisch erzogen wurden. Orthodoxe und konservative Strömungen dagegen halten an dem jüdischen Religionsgesetz fest.
Aus mehrheitsgesellschaftlicher Perspektive ist es wichtig zu verstehen, dass Menschen mit jüdischem Familienhintergrund unabhängig von Fremd- oder Selbstdefinition häufig antisemitischer Diskriminierung und Anfeindungen ausgesetzt sind.
Weiterführende Informationen: